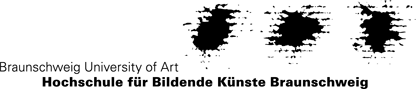Refine
Keywords
- Die Stadt und ihr Imaginäres : Raumbilder des Städtischen (2012)
- Die vorliegende Analyse zeitgenössischer urbaner Räume untersucht an ausgewählten Raumbildern des Städtischen, wie in diesen imaginäre Kräfte wirksam werden. Der Begriff des Raumbilds hat unterschiedliche Bedeutungen. Zum einen bezeichnet er die Raummetaphern, also Sprachbilder des Räumlichen. Hinzu kommt die mediale Vermittlung in nichtverbalen Zeichen- und Symbolsystemen, die wiederum Bilder von Räumen entwerfen, die in besonderer Weise auf die Raumvorstellungen und die realen Räume zurückwirken. Zum anderen bezeichnet der Begriff des Raumbilds die symbolische Anordnung materialisierter Umwelten. Im ersten Abschnitt wird ausgehend von Henri Lefèbvres Raum- und Stadttheorie am Beispiel der „Welt als Stadt” das Sprachbild, die Denkfigur und die Bildformel untersucht. Der Begriff der Stadt wird in unterschiedlichen historischen Kontexten analysiert. Im zweiten Abschnitt steht die symbolische Bedeutung von Raumbildern, ihr projektiver Charakter hinsichtlich der Perspektiven städtischer Entwicklung als auch ihre psychische Wirkmächtigkeit und ihr Einfluss auf alltägliche urbane Erfahrungen im Fokus der Analyse. Die Themenparks der neugegründeten chinesischen Stadt Shenzhen, die Raumentwicklung im Kern Europas mit ihrer nahezu gesamtterritorialen Urbanisierung sind ebenso Gegenstand wie die Neukonfiguration des Städtischen in globalen Netzwerken. Um das in den zeitgenössischen Formen der Urbanisierung wirksam werdende Imaginäre als produktive, verändernde Kraft erfassen zu können, wird die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Städtischen, sei es in Architektur, Literatur, Film oder bildender Kunst, einbezogen. Ausgehend von Cornelius Castoriadis’ Theorie des Imaginären als einer schöpferischen Kraft, die neue gesellschaftliche Sinnhorizonte eröffnet, zeigt die Untersuchung des urbanen Imaginären neue Perspektiven zum Verständnis der gegenwärtigen Urbanisierung auf.
- Am Rande des Sehens : Kunst in Schwellen und Zwischenräumen
- Die Dissertation mit dem Titel „Am Rande des Sehens. Kunst in Schwellen und Zwischenräumen“ untersucht exemplarisch Kunstwerke in musealen Schwellen und Zwischenräumen, die zu Transformatoren am Rande des Sehens, zu Entscheidungsträgern und Übersetzungsmedien des Baus, aber auch der Kunst in den Funktionsräumen der Museen werden können. Jenseits konventioneller Platzierungen in den Randzonen des Raumes, den Treppenanlagen, Korridoren, Rampen, die nicht länger bloße Verteiler sind, sondern zu Schwellen und Übergangsbereichen aufgewertet werden, installieren Künstler wie Gerhard Merz, Dan Flavin, Daniel Buren, Jenny Holzer, Beat Streuli, Richard Artschwager, Lothar Baumgarten, Joachim Manz, Karin Sander, Robert Kusmirwoski, Imi Knoebel und Wolfgang Hainke ihre Werke, wird Raum, Ort und Übergangsmoment erfahrbar. Die ausgewählten und besprochenen Kunstwerkbeispiele zeigen als neue Art von Museumskunst, wie wirkungsvoll der Gebrauchscharakter des Gebäudes und seiner Erschließungsräume aufgeladen werden kann und inszenieren damit dank ihrer gezielten Platzierung Eigenräume mit neuen Aufenthaltsqualitäten. Somit treten auch die musealen Präsentationsformen in den Vordergrund, die in Relation zur vorgefundenen Gestaltung der musealen Schwellen und Zwischenräume neu gedacht werden können. Es geht nicht mehr um das Aufbrechen eingefahrener Sehgewohnheiten, sondern um sinnliche Wahrnehmungsvorgänge bzw. mentale Orientierungsleistungen. So entsteht ein gemeinsamer Aufenthaltsraum von Kunst und Betrachter. Der Gegenstand der Betrachtung wird neuer Ort der Erfahrung.
- Sein Leben ändern - aber wie? : Lebenskunst nach Rupert Lay, Hermann Schmitz und Wilhelm Schmid (2013)
- Die Dissertation „Sein Leben ändern – aber wie? Lebenskunst nach Rupert Lay, Hermann Schmitz und Wilhelm Schmid“ untersucht am Beispiel dieser drei Denker, ob und wie es heute möglich ist, sein Leben zu ändern, und zwar so zu ändern, dass man von einem „richtigen“ Leben sprechen könnte. Lay ist ein jesuitischer Moralphilosoph, Schmitz der Gründer der Neuen Phänomenologie, Wilhelm Schmid ein erklärter Philosoph der Lebenskunst; alle drei haben sich instruktiv zu Fragen des richtigen Lebens und der Lebenskunst geäußert. Im Zusammenhang mit den Konvergenzen und Differenzen ihrer Werke wird auch herausgearbeitet, wie die drei Philosophen sich zur Frage der Autonomie verhalten – scheint Autonomie doch eine notwendige Voraussetzung dafür zu sein, das eigene Leben zu ändern. Der Titel der Arbeit bezieht sich auf Peter Sloterdijks 2009 erschienenes „Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik“. Zu diesem Werk werden vier Thesen aufgestellt, die als Maßstab dienen, die Lehren von Lay, Schmitz und Schmid einzuschätzen. Im letzten Kapitel der Dissertation werden – orientiert an den besprochenen Philosophen – einige vorsichtige Vorschläge gemacht, wie man man richtig leben könne. Dabei wird die Möglichkeit, sein Leben selbstmächtig-autonom zu ändern und ein anderer Mensch zu werden, skeptisch gesehen; nach den Ergebnissen der Arbeit scheint es aber unter bestimmten Bedingungen möglich zu sein, man selbst zu werden. Eine besondere Rolle spielt dabei ein neues, neophänomenologisch beeinflusstes Verständnis von „Autonomie“.